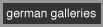erman galleries / index cities / index galleries / index artists / index Kassel
Kunsthalle Fridericianum
Friedrichsplatz 18
34117 Kassel
Tel. 0561 - 70 72 720; Fax 0561 - 77 45 78
Mi - So 11 - 18 Uhr
info@documenta.de
http://www.fridericianum-kassel.de
http://www.documenta.de
aktuelle Ausstellung / current exhibition
vorausgegangene Ausstellung / previous
exhibition
02.04. - 18.05.2003
Kuratorenwerkstatt Fridericianum
In Kooperation mit apexart, New York
"Denn man sieht nur die im Lichte. Shadow Cabinets in a Bright Country."
Kurator: Ted Purves, San Francisco
"Walking in the City"
Kuratorinnen: Melissa Brookhart Beyer, New York, und Jill
Dawsey, San Francisco
Kuratorenwerkstatt Fridericianum
Ein Ort zeitgenössischer Kunst ist immer auch ein Experimentierfeld,
wobei nicht nur Künstlern, sondern auch Kunstvermittlern
die Möglichkeiten des Entdeckens zugestanden werden müssen.
Das mit diesem Jahr beginnende Projekt Kuratorenwerkstatt
Fridericianum holt junge Kuratoren und Kuratorinnen aus unterschiedlichen
Ländern an die Kunsthalle, um ihnen hier einerseits das
Sammeln praktischer Erfahrungen zu ermöglichen, andererseits
ihre eigenen Ideen und Vorstellungen in die Ausstellungstätigkeit
einzubringen. Zusätzlich öffnet sich die Kuratorenwerkstatt
zu einer intensiven Kooperation mit dem apexart Curatorial Program,
New York. Hier werden junge Kuratoren dazu eingeladen, themenspezifische
Ausstellungen zu entwickeln, wodurch sich ein facettenreiches
Feld von Fragen und Ansätzen zu zeitgenössischer Kunst
und Kultur ergibt. In Kooperation mit apexart werden zukünftig
jährlich zwei Ausstellungen konzipiert, die sowohl in New
York als auch in Kassel zu sehen sein werden. Beide Ausstellungsräume
werden so miteinander vernetzt.
Denn man sieht nur die im Lichte. Shadow Cabinets in
a Bright Country
Als erster Gastkurator wird Ted Purves aus San Francisco
in Kassel präsent sein. In seiner Ausstellung Shadow
Cabinets in a Bright Country bezieht sich der Kurator auf
den massiven Rückgang des staatlichen Engagements im Bereich
des Sozialen, die die USA seit dem Regierungsantritt von George
Bush verzeichnen. Bush hatte in seiner 1989 gehaltenen Amtsantrittsrede
durch seinen Aufruf zur Nächstenliebe die soziale Verantwortung
gegenüber den schwächer Gestellten auf die Bürger
der USA übertragen. Doch der Rückzug des Staates aus
demSozialsystem öffnete diesen Bereich nicht zuletzt auch
für private Initiativen, deren Vorstellungen von notwendigen
Hilfeleistungen sich womöglich von denen Bushs unterscheiden
man denke beispielsweise an den privat initiierten Verkauf
von Marihuana zu medizinischen Zwecken.
Mit dem Begriff des Schattenkabinetts greift Ted Purves daher die Idee einer politischen Gruppierung auf, die obgleich als Opposition offiziell machtlos durch die "Schöpfung metaphorischer und symbolischer Alternativen" (Ted Purves) Einfluss nehmen. Tatsächlich zeigen aktuelle Tendenzen innerhalb der Gegenwartskunst, dass von Künstlerinnen und Künstlern initiierte Projekte immer häufiger auf die Vermittlung von Waren und Dienstleistungen an das Publikum abzielen. Dem Besucher wird ermöglicht, dieser Kunst nicht nur als Betrachter gegenüberzutreten, sondern sich durch Teilnahme, Assistenz und Diskussion zu engagieren.
So fördert die Gruppe "it can change" (San
Francisco) mit ihrem Kasseler Projekt nicht nur die soziale Kommunikation,
sondern zugleich hinterfragt sie auch den Begriff des Warenwerts:
Passanten werden eingeladen, sich innerhalb des Ausstellungsraums
eines von 30 dort präsentierten Kleidungsstücken gegen
eigene einzutauschen. Die Kleidungsstücke sind wiederum
mit Tauschinstruktionen versehen, so dass sich auch außerhalb
des Ausstellungsraumes der Vorgang von Übernahme/Tausch/Weitergabe
fortsetzt. Kommunikation und Austausch, aber auch die
Einflussnahme auf die Öffentlichkeit ermöglicht "Cambalache
collective" (Sevilla, London, Paris): Unter dem Titel Rote
Ampel wird die Gruppe mit einem als mobiles Mischpult umgestalteten
Transporter an Straßen und Plätzen öffentliche
DJ-Sessions durchführen, zu denen die Passanten eigene Musik,
Geräusche, Statements beitragen können. "Nuts
Society" (Bangkok) hält Workshops zum Thema Writing
Thai A Learning Reform an, während Katrin Böhm
und Stefan Saffer (London, Berlin) auf ein sehr aktuelles Thema
der Stadt eingehen: Mit einem Modellbau-Workshop bieten sie einen
vielleicht hilfreichen Beitrag zu Kassels Bewerbung zur Kulturhauptstadt
2010 einem Thema, das die Stadt aktuell bestimmt.
Die zunächst auf die amerikanische Situation ausgerichtete Ausstellung beweist damit einen hohen Flexibilitätsgrad, indem sich die beteiligten Künstlergruppen auf den neuen Ort und seine individuellen Gegebenheiten einstellen und diese konkret in ihre Arbeit einbeziehen.
Walking in the City
Mit der Ausstellung Walking in the City untersuchen
die Kuratorinnen Melissa Brookhart Beyer und Jill Dawsey die
räumlichen Praktiken innerhalb der Kunst von der Mitte der
60er Jahre bis zur Gegenwart.
Ausgehend vom Topos des Flaneurs, einer paradigmatischen Gestalt
des 19. Jahrhunderts, der sich
mit schlendernder Leichtigkeit Raum erobert, zeigen die Kuratorinnen
durch ihre Auswahl zeitgenössischer Positionen ein breites
Spektrum an räumlichen Erfahrungen. Deutlich werden dabei
immense Unterschiede in Qualität und Quantität des
zu erfahrenden, zu erobernden Raums, der insbesondere durch die
Präsenz des eigenen Körpers innerhalb dieses Raums
artikuliert wird.
Deutlich wird dies durch Kim Sooja, deren Videoinstallation A
Needle Woman den urbanen Raum mitdem landschaftlichen konfrontiert.
Sie selbst dient als Referenzpunkt für das Erlebnis des
überfüllten, hektischen Stadtraums und der Existenz
in einer stillen, kontemplativen Landschaft.
So bezeichnete der öffentliche Raum für Künstlerinnen
und Künstler in den späten 60er und den 70er Jahren
Möglichkeiten revolutionärer Art. Yayoi Kusama stellte
in ihrem Walking Piece, für das sie 1966 im Kimono
die Industriezonen Manhattans durchwanderte, Fragen nach Fremdheit
und Migration. Ein Thema auch für Adrian Piper, die sich
in ihrem Video Mythic Being von 1973 mit der Problematik
von Rasse und Gender befasst, indem sie als bedrohlich wirkender
Schwarzer verkleidet die Straßen New Yorks abläuft.
Im Gegensatz zur Form der Wanderung zeigt Valie Export in ihren
Body Configurations series (1972-76) - in denen sie sich,
bzw. ihren Körper an verschiedenste architektonische Gegebenheiten
anlehnt - die Möglichkeiten und Grenzen der körperlichen
Anpassung an den Raum.
Wurde in den 60ern und 70ern die Stadt begriffen als ein Raum,
innerhalb dessen man die Öffentlichkeit mit der immensen
Unterschiedlichkeit gelebter Erfahrungen konfrontieren konnte,
legen es die aktuelleren Positionen nach Erfahrung der Kuratorinnen
stärker auf eine Bestätigung des
eigenen Daseins an. Der alltägliche Raum wird ethnographischen
Untersuchungen unterzogen, durch Bestimmungen und Gesetze gebildete
Grenzen werden visualisiert. Der urbane Raum wird als ein Gewebe
verschiedenster Interessen, Möglichkeiten und Bedürfnisse
begriffen.
Sehr deutlich macht dies das Video Upward Mobility, in
dem Alex Villar sich den städtebaulichen Vorgaben und Einflussnahmen
auf die eigene Mobilität widersetzt: Konsequent verfolgt
er einen von ihm festgelegten Weg, indem er Autos, Telefonzellen,
ja ganze Gebäude überklettert. Die Strategie einer
persönlichen Aneignung des urbanen Raums verfolgt auch Valerie
Tevere in ihrem interaktiven
DVD-Projekt A Preliminary Guide to Public and Private Space
in Amsterdam. Durch Interviews mit Anwohnern, frei anwählbaren
Einstellungen von öffentlichen und privaten Räumen
und variable Ruten entsteht eine neue Kartographie der Stadt.
Eine Kartographie, die die Möglichkeiten wie Grenzen der
Nutzung des urbanen Raums visualisiert.
Zu den Ausstellungen erscheint eine Dokumentation, die am 16. Mai 2003 vorgestellt wird.