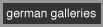german galleries / index
cities / index galleries
/ index artists / index
Munich
Pinakothek der ModerneBarerstrasse 40
08.12.2006 - 11.03.2007 Architektur wie sie im Buche stehtFiktive Bauten und Städte in der Literatur Architekturmuseum der TU München in der Pinakothek der Moderne
Erfundene Architektur ist ein wichtiger Bestandteil der Weltliteratur. Bei jedem, der Beschreibungen von Architektur liest - von der Gralsburg bis zu Kafkas Schloss und von Atlantis bis Shangri-La - entstehen Räume und Bauten im Kopf. Wie stellen sich aber die Schriftsteller die von ihnen erfundene Architektur vor, woher nehmen sie ihre architektonischen Ideen und welche Bedeutung oder Funktion haben fiktive Bauten in der Dichtung? Diese »Architektur wie sie im Buche steht« behandelt erstmals die neue Ausstellung des Architekturmuseums der TU München.
Gezeigt werden die eigenhändigen Skizzen, mit denen Gottfried Keller, Gustave Flaubert, Theodor Fontane, Heinrich Mann, J.R.R. Tolkien, William Faulkner, Friedrich Dürrenmatt, Vladimir Nabokov, Günter Grass oder Umberto Eco ihre Raumerfindungen für sich zu klären versuchen. Eine Abteilung behandelt das Zusammenwirken von Architektur und Text im Comic, eine andere verfolgt die erfundenen Räume von François Rabelais, John Milton, E.T.A. Hoffmann, Adalbert Stifter, Franz Kafka oder Thomas Bernhard. In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Stadtraum und Stadtentwicklung der TU München entstanden nach den Beschreibungen fiktiver Städte anschauliche Modelle von Campanellas Sonnenstadt, Goethes Pädagogischer Provinz oder George Orwells »1984«. Im Zentrum der Ausstellung wird dargestellt, wie fiktive Bauten Architekten und Künstler zu Zeichnungen, Gemälden und Skulpturen anregten, und wie manchmal sogar aus dem Erfundenen oder Erträumten reale Architektur wurde, beispielsweise die phantastische Città ideale, die sich der Architekt Tomaso Buzzi nach literarischen Motiven in Umbrien errichtete, Wilhelm Hauffs Burg Lichtenstein, die in Württemberg nach dem gleichnamigen Roman gebaut wurde, oder die weiße Stadt aus Emile Zolas »Arbeit«, die Tony Garnier teilweise in Lyon verwirklichte.
Durch Zeichnungen, Modelle und Computersimulationen wird erfundene Architektur aus zwei Jahrtausenden sichtbar gemacht. Die Materialisierung der poetischen Luftschlösser hilft, tiefer in die Welten und Räume der Dichter einzudringen, und sie kann beitragen, sich besser in den Labyrinthen fiktiver Bauten und Städte zu orientieren. Der Schriftsteller Arno Schmidt hat in einem Schreiben an den Rowohlt Verlag 1950 die Bedeutung der genauen Kenntnis der Räume des Dichters treffend beschrieben: »Stets habe ich bisher, in allen stories of fiction, mit neugierigem Bedauern vermißt, daß der Dichter einmal seine räumliche Vision dem Leser vorgelegt hätte. Beim Lesen ist es ja stets so, daß der Leser sich die Szenerie in ein kurioses Eigenland verlegt; sollte es nicht von größtem Wert sein, wenn er auch einmal erführe, wie sich der Poet selbst so die Lokalitäten gedacht hat?!«
Für die Ausstellung wurden fast 400 Exponate aus internationalen Museen, Archiven und Sammlungen zusammengetragen. Gezeigt werden Gemälde, Graphiken, Skizzen, Buchwerke, Skulpturen, Animationen sowie zahlreiche Modelle, die zur Visualisierung literarischer Räume und Städte eigens angefertigt werden. Zu den besonderen Höhepunkten zählen die erstmals gezeigten Skizzen Umberto Ecos für den Roman »Der Name der Rose«, die Originale der belgischen Künstler Schuiten und Peeters für die Comic-Serie »Die geheimnisvollen Städte« oder Karl Friedrich Schinkels Gemälde »Die Stadt am Strom« aus der Alten Nationalgalerie in Berlin, das aus einem künstlerischen Wettstreit des Architekten mit dem Dichter Clemens Brentano entstand.
Zur Ausstellung erscheint im Anton Pustet Verlag Salzburg ein Katalog mit 568 Seiten und 380 farbigen Abbildungen, der im Museumsshop zum Preis von 39 Euro erhältlich ist. An Hand von 120 Beispielen aus der Weltliteratur, in 15 Fachbeiträgen und einem Text von Martin Mosebach wird die »Architektur wie sie im Buche steht« vorgestellt.
Pressevorbesichtigung: 07.12.2006, 11.00 Ausstellungseröffnung: 07.12.2006, 19.00
Führungen DO 14.12. | 28.12. | 11.01. | 25.02. | 08.02. | 22.02. | 08.03. | 18.00
Begleitprogramm in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Max-Joseph-Platz | jeweils 19.00 01.02.2007 | Gespräch über Architektur und Literatur mit Friedrich Achleitner, Eugen Gomringer, Gert Heidenreich, Stefan Huber, Martin Mosebach 08.02.2007 | Vortrag und Lesung von Günter Kunert 22.02.2007 | Vortrag von Prof. Dr. Werner Frick, »In der Asphaltstadt bin ich daheim«: Urbane Szenarien in der Literatur der klassischen Moderne
Vortrag Roger M. Buergel, künstlerischer Leiter der documenta 12 MI 14.02. | 19.30 | Pinakothek der Moderne, Ernst von Siemens-Auditorium | Eintritt frei, Einlass ab 18.30
Vier Monate vor Eröffnung der alle fünf Jahre stattfindenden Kasseler Kunstschau lädt PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne zu einem Vortrag mit Roger M. Buergel ein. Die Begrüßung und eine kurze Einführung erfolgt durch Frau Prof. Dr. Schulz-Hoffmann. Roger M. Buergel wird in seinem Vortrag einen der Hauptaspekte seines Gesamtkonzeptes für die documenta 12 vorstellen.
Dazu Roger M. Buergel: »Migration der Form: Eine Ausstellung wie documenta braucht so etwas wie einen roten Faden. Schließlich gilt es Dinge, also künstlerische Formen und Themenstellungen, zueinander in Beziehung zu setzen, damit das Publikum nicht vor jedem Werk erneut wie der Ochs vor dem Scheunentor steht. Die »Migration der Form« ist als solch ein roter Faden gedacht. Als kuratorische Methode widmet sie sich den anschaulichen, manchmal dramatischen Wechselwirkungen historischer wie zeitgenössischer Formschicksale.«
Roger M. Buergel *1962, Ausstellungsmacher und Autor, zwei Kinder Kuratierte Ausstellungen: »Dinge, die wir nicht verstehen« (mit Ruth Noack, Generali Foundation, Wien, 2000) »Gouvernementalität. Kunst in Auseinandersetzung mit der internationalen Hyperbourgeoisie und dem nationalen Kleinbürgertum« (Alte Kestner Gesellschaft Hannover, 2000) »The Subject and Power the lyrical voice« (CHA Moskau, 2001) »Die Regierung« (mit Ruth Noack, Kunstraum der Universität Lüneburg; MACBA-Museu d'Art Contemporani de Barcelona; Miami Art Central; Secession, Wien; Witte de With, Rotterdam, 2003 05) Künstlerischer Leiter der documenta 12 (2007)
27.02. - 11.03. 2007 Erwin Pfrang"Ulysses" von James Joyce Ausstellung der Staatlichen Graphischen Sammlung in der Pinakothek der Moderne
Die Staatliche Graphische Sammlung präsentiert vom 27. Februar bis zum 11. März 2007 im Vitrinenkorridor der PdM neue monumentale Zeichnungen von Erwin Pfrang. Es handelt sich um einen Zyklus zur »Hades«-Episode des »Ulysses« von James Joyce, jenes Werks, das den Künstler seit langem intensiv beschäftigt. In unserer Ausstellung »Erwin Pfrang Arbeiten auf Papier« in der Neuen Pinakothek war ein erster Zyklus zu Joyce bereits 1998 zu sehen. Die Arbeiten hat der Künstler vergangenen Sommer in seinem Atelier in Catania/Sizilien in einer für ihn neuartigen Technik (Tusche auf Ziegenhaut) geschaffen. Sie markieren eine radikale Wendung hin zum Großformat. Pfrangs typische Handschrift, in der gewöhnlich der Mikrokosmos des Zeichnerischen dominiert, gewinnt in der eigentümlichen Materialität hier einen überraschend expressiven Duktus und eine fast gestische, bildhafte Eindringlichkeit. Seit Anfang der 80er Jahre verfolgt die Staatliche Graphische Sammlung das zeichnerische Schaffen Pfrangs, das eine unverwechselbare Stellung innerhalb der zeitgenössischen Zeichenkunst behauptet. Die Präsentation dieser Arbeiten aus dem Besitz SKH Herzog Franz von Bayern, die im Herbst 2006 bei David Nolan in New York zu sehen waren, begleitet eine Katalogpublikation (68 Seiten, Preis 15 Euro), die sich thematisch an unseren 1998 erschienen Katalog anschließt. Aus Anlass der Pressevorstellung gibt Harald Beck, der renommierte Joyce-Interpret und Übersetzer, eine Einführung.
Kurator: Michael Semff
10.03. - 20.05. 2007 Gijs Bakker AND Jewelry
Innovativ ist Bakker auch in der Wahl seiner Materialien und Techniken. So verwendet er ungewöhnliche Stoffe wie Aluminium, Plastik, Holz, Blumen und Blattgold und kombiniert z.B. mit PVC laminierte Fotografien mit Edelsteinen und Metallen. Von 1958 bis 1962 studierte er Gold- und Silberschmiedekunst am Amsterdamer Instituut voor Kunstnijverheid (heute Rietveld Akademie) und begann seit etwa Mitte der sechziger Jahre zusammen mit seiner Frau Emmy van Leersum (1930-1984) neue Wege im Schmuck zu erarbeiten. Die »Swinging Sixties« brachten ihm den Durchbruch: Für die jungen Frauen der Zeit wurden Bakkers geometrisch abstrakte Schmuckstücke ein modisches »Muss«. In den 70er und 80er Jahren erlangen die Entwürfe Bakkers dann eine völlig neue Qualität: Der so genannte Profilschmuck für Fritz Maierhofer oder für seine 1984 verstorbene Frau Emmy van Leersum sind untrennbar mit dem Träger verbunden und betonen dessen Einzigartigkeit, indem sie sich diesem genau anpassen. Die späteren Werke kommentieren oft kritisch, aber auch augenzwinkernd Umwelt und Mitmenschen. Dem Thema Autorenschmuck widmet sich Die Neue Sammlung das Staatliche Museum für angewandte Kunst in München seit längerem intensiv und hat ihm einen großen, permanenten Ausstellungsbereich eingeräumt: die »Danner-Rotunde« in der Pinakothek der Moderne. Vor diesem Hintergrund findet nun im 2.OG der großen Rotunde die Beschäftigung mit einem der Umstürzler der sechziger Jahre statt. Die Ausstellung bietet Einblicke in das, die herkömmlichen Grenzen der freien und angewandten Künste negierende Oeuvre von Gijs Bakker. Eine Ausstellung der Neuen Sammlung in Kooperation mit SM´s Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch Publikation zur Ausstellung: Yvonne Joris/Ida van Zijl, Gijs Bakker and Jewelry. 272 Seiten mit 491 meist farbigen Abbildungen. Text englisch/niederländisch. Design: Anthon Beeke. 49,80 Euro Der Künstler wird sowohl zur Pressekonferenz als auch zur Eröffnung am Abend anwesend sein. Zu beidem sind Sie herzlich eingeladen. Siehe auch die Einladung in der Anlage. Pressevorbesichtigung: Donnerstag, 08.03.07, 11.00 Eröffnung: Freitag, 09.03.07, 19.00 (öffentlich)
Ausstellungsort: Die Neue Sammlung. Design in der Pinakothek der Moderne
Neuerwerbung für die Pinakothek der Moderne
Georg Baselitz Der Mann am Baum, 1969 Öl auf Leinwand 250 x 200 cm
Die bedeutende Georg Baselitz Sammlung in der Pinakothek der Moderne ist um das frühe Hauptwerk »Der Mann am Baum« von 1969 erweitert worden. Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds, der das Gemälde kürzlich erworben hat, stellte es großzügigerweise dauerhaft zur Verfügung. Damit bereichert ein epochales Schlüsselwerk des Künstlers die gewichtige Sammlung deutscher Kunst der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Sammlung Moderne Kunst, die entschieden durch das sammlerische Gespür und Engagement von SKH Herzog Franz von Bayern geprägt ist.
Das Gemälde »Der Mann am Baum« kann als der Beginn einer Schaffensphase gesehen werden, in der Baselitz einen radikal anderen Ansatz riskierte, nämlich die Umkehrung eines Bildmotivs. Über viele Jahre wird dies fast zu einem Markenzeichen.
Zwischen den Polen einer weltweit lange Jahre bestimmenden Abstraktion einerseits und einer durch die Pop Art neu etablierten Gegenständlichkeit andererseits markierte Baselitz mit einem Paukenschlag einen ganz eigenständigen, neuen Weg, der Grenzen aufhob.
Durch die Inversion des Bildmotivs wird dessen eindeutige inhaltliche Festlegung unterlaufen. Diese bleibt jedoch als formale Kontrollinstanz für die Gesamtkomposition erhalten. Die flächendeckende, grau-grüne und stark mit Weiß aufgemischte Farbgestaltung verbindet den Mann, dessen Kopf wie zusammengequetscht auf einer Art Stacheldraht aufliegt, mit dem raum- und ortlosen Bildgrund. Es entsteht eine emblematisch starke Bildstruktur ohne erzählerische oder anekdotische Eindeutigkeit.
Baselitz hat diesen hier in aller Klarheit formulierten Gedanken eines Bildes jenseits von Figuration und Abstraktion konsequent und mit stets neuem Risiko bis hin zu den »Remix«-Werken der letzten Jahre weiterentwickelt.
Es ist ein besonderer Glücksfall, dass durch die Erwerbung von »Der Mann am Baum« alle zentralen Werkphasen des Künstlers mit exemplarischen Bildern in einzigartiger Dichte in der Pinakothek der Moderne gezeigt werden können und dass damit die für die Sammlungsstrategie insgesamt charakteristische Schwerpunktbildung eine weitere Akzentuierung erfährt.
|
||
| germangalleries.com - Index München | ||