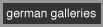german galleries / index cities / index galleries / index artists / index Cottbus
Brandenburgische Kunstsammlungen Cottbus
seit 2009: Dieselkraftwerk
Cottbus
über die Brandenburgischen
Kunstsammlungen
aktuelle Ausstellung / current exhibition
vorausgegangene Ausstellung / previous
exhibition
27.9. - 8.11. 1998
ars viva 98/99
Installationen
Der 1951 ins Leben gerufene und alljährlich vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. vergebene ars viva-Preis für bildende Kunst wird in diesem Jahr am 26. September in den Brandenburgischen Kunstsammlungen Cottbus an die Künstler Kai Althoff, Lothar Hempel, Manfred Pernice, Torsten Slama und Sean Snyder vergeben. Die Preise sind mit je 10.000 DM dotiert.
Das Thema der ars viva 98/99 lautet Installationen. Mit dieser Wahl hat der Kulturkreis einen neuen Akzent gesetzt, der die Loslösung von eindeutigen Gattungseinteilungen wie Malerei, Skulptur, Handzeichnung, Fotografie und Videokunst reflektiert.
Im Verständnis der letzten 30 Jahre lassen sich Installationen vornehmlich als ortsspezifische Arbeiten bestimmen. Daher verlangte auch der Begriff der Installation im Vorfeld der Jurierung nach aktueller Definition.
Die Arbeiten der hier ausgewählten Künstler, die zwischen 1963 und 1972 geboren sind, präsentieren sich im musealen Rahmen oder im öffentlichen Raum unter völlig neuen Vorzeichen. Sie schaffen sich eigenwillige, oftmals irritierende Kontexte und schöpfen aus dem Fundus von privaten Erinnerungsfragmenten einzelner Kapitel unseres Lebens.
Hinsichtlich des urbanen Raumes geschieht dies im Werk von Manfred Pernice mit der Zwitterhaftigkeit von Gegenständen, die Skulpturen und zugleich Gebrauchsgüter zu sein scheinen. Die Störung des Eindeutig-Definierbaren durchzieht die einzelnen Arbeiten in jeglicher Weise. Die Problematik der Austauschbarkeit von Ordnungen sowie der Verwischung von Grenzen rückt damit in das Blickfeld des Betrachters.
Auch Sean Snyder befragt die Kunst nach ihrer heutigen Funktion. Sein Agieren ist eindeutiger auf den urbanen Raum bezogen, jedoch geht es hier um Überprüfung der Stimmigkeit von architektonischer und sozialer Funktion. Durch die expliziten Untersuchungen wird erkennbar, daß urbane Abläufe vielfach gestört und soziale Kontakte verletzt werden. Snyders bildliche Offenlegungen steigern die Absurdität mancher Ästhetisierung und Scheinfunktionalisierung.
Auf den Werktypus der drei Künstler Kai Althoff, Lothar Hempel und Torsten Slama könnte man mehr noch als den Begriff der Installation den der Inszenierung anwenden.
Die Szenerien bestehen aus einer halb realen, halb fiktiven Welt; Dichtung und Wahrheit verweben sich untrennbar miteinander. Der Künstler erzählt eine Geschichte, eine komplett durchkonstruierte Story, in die sein eigenes Leben aber durchaus hineinspielt. Mühelos werden die Genres gewechselt, ob als Zitat aus der Literaturgeschichte oder als musikalischer Ausschnitt. Im Rückgriff auf die Kultur der 70er und 80er Jahre machen sich die Künstler diese Jahrzehnte in Revivals verfügbar, mit entsprechendem Mobiliar und Ambiente, Drinks und Pop-Songs. In unverwechselbaren Arrangements lassen sie Momente und Ereignisse der Nach-68er-Zeit wieder auferstehen.
Titel wie "Aber wir wundern uns nicht mehr", "Geschworen hat's sich damals leicht", "Auf guten Rat folgt Missetat", "Hast Du heute Zeit?- Ich aber nicht" deuten an, daß es sich nicht mehr lohnt, alten Hoffnungen nachzuhängen. Mit einer gehörigen Portion Skeptizismus wird darauf verwiesen, daß wohl kein Weg an Enttäuschungen vorbeiführen wird, die Erwartungen an das Leben allein über eine individuelle Glückssuche zu erfüllen sind. Nach dem Wegfall aller Orientierungsmuster nimmt diese Generation die Inszenierung des Lebens selbst in die Hand.
Nach Cottbus wird die Ausstellung im Kunstverein Braunschweig und im Portikus Frankfurt/Main gezeigt.
Dr. Perdita von Kraft
21.10. - 6.12. 1998
Die Fotografin Ellen Auerbach
Retrospektive
Diese Ausstellung - die bisher größte Retrospektive des fotografischen Werkes von Ellen Auerbach in Deutschland - wurde bereits mit überwältigendem Erfolg in der Akademie der Künste, Berlin - Brandenburg, gezeigt. Die ca. 130 ausgewählten Fotografien geben einen Überblick über das zwischen 1929 und 1965 entstandene fotografische Oeuvre der heute 92jhrigen "grande dame der Fotografie".
Geboren als Ellen Rosenberg in Karlsruhe, ging sie 1929 nach einem mehrjährigen Studium der Bildhauerei in Karlsruhe und Stuttgart nach Berlin und erhielt als Privatschülerin eine Ausbildung beim Fotografen Walter Peterhans. Noch im selben Jahr, nachdem ihr Lehrer an das Bauhaus nach Dessau berufen wurde, gründete sie gemeinsam mit ihrer Mitschülerin Grete Stern das Fotostudio "ringl + pit", das sich auf Werbe- und Porträtfotografie spezialisierte und sich rasch etablierte. Beeindruckende Zeugnisse der Berliner Atelier- und Wohngemeinschaft mit Grete Stern sind neben einigen Künstlerportraits vor allem die Sach- und Werbefotografien, die sich von den üblichen Reklamebildern der Weimarer Republik durch Humor, Ironie und Provokation hervorheben. Ein Paradebeispiel für die originellen und respektlosen Bildinszenierungen ist die legendäre Aufnahme "KOMOL", die auch auf internationale Anerkennung stieß.
Nach Hitlers Machtübernahme 1933 verließ die Jpdin ihr Geburtsland. Über Palästina und London emigrierte die Fotografin 1937 in die USA. In den Staaten experimentierte sie gemeinsam mit ihrem Mann Walter Auerbach mit infrarotem und ultraviolettem Licht und beschäftigte sich intensiv mit dem Carbodruck, einer Technik der Farbfotografie. 1944 zog sie nach New York und wurde durch ihre Fotoaufträge für "Time Magazine" und "Columbia Masterworks" bekannt.
Standen die Bilder der Berliner Zeit noch unter dem Einfluß der avantgardistischen Fotografie der zwanziger Jahre, so fand die Fotografin in den nachfolgenden Jahren einen eigenen Stil, der sich jenseits eines grellen Voyeurismus durch große Sensibilität für "magische Augenblicke" in Alltagskonstellationen auszeichnete. Aufgrund ihres außergewöhnlichen Gespürs für Menschen und Situationen gelang es Ellen Auerbach, in alltäglichen und unspektakulären Begebenheiten unvergeßliche Bildmomente zu entdecken und sie mit Hilfe ihrer Kamera in zeitlosen, poetischen Aufnahmen festzuhalten. Rückblickend formuliert Ellen Auerbach den Anspruch an ihre Arbeiten folgendermaßen: "Ich habe mich in meiner fotografischen Arbeit bemüht, nicht nur das zu zeigen, was man vordergründig sehen kann, sondern das darunterliegende Wesen der Dinge darzustellen." Sie nennt es ihr "drittes Auge", das hinter dem Sichtbaren auch das Verborgene, das Unsichtbare, das Wesentliche erkennt. Dieses "dritte Auge" begleitete die Fotografin auch auf ihren Reisen nach Mexiko, Mallorca, Norwegen und Argentinien, die sie von 1955 bis 1965 unternahm. Die dabei entstanden Aufnahmen sind keine typischen Reisefotografien, sondern einfühlsame, stimmungsvolle Bilder von Landschaften und Menschen, deren besonderer Anziehungskraft man sich nicht entziehen kann.
Mitte der sechziger Jahre fotografierte Ellen Auerbach allmählich immer weniger. Sie wagte damals - wie schon so oft in ihrem Leben - einen Neuanfang, indem sie sich einer ganz anderen beruflichen Herausforderung zuwandte: der therapeutischen Arbeit mit lerngestörten Kindern.
Carmen Schliebe