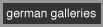lothringer dreizehn
Ort für zeitgenössische Kunst / Space for Contemporary
Art
Lothringer Straße 13
81667 München
Tel. 089 - 448 69 61, Fax 089 - 688 62 44
Di - So, 13 - 19 Uhr / Tue - Sun, 1 - 7 p.m.
info@lothringer-dreizehn.com
www.lothringer-dreizehn.com
lothringer13/program angels
mediale experimente
do - so 16 - 19 uhr / jetztredi - jour fix jeden monatsersten
um 20 uhr
tel +49-89-45911905 / fax +49-1212-562849645
mailto:alle@programangels.org
www.programangels.org
aktuelle Ausstellung / current exhibition
vorausgegangene Ausstellung
/ previous exhibition
22.01. - 21.03. 2010
Armando Lulaj
Silent Sozial Corruption
kuratiert von Adela Demetja
"Politik selbst hat mich nie interessiert, wenn ich es so
formulieren kann. Ich versuche nur auf poetische Weise über
Politik zu reden. Was meine Arbeiten in einen politischen Kontext
rückt, sind die Analysen," so Armando Lulaj während
der Vorbereitungen zur Ausstellung.
Der Künstler, geboren 1980 in Albanien, lebt und arbeitet
seit einigen Jahren in Italien. Seine erste Einzelausstellung
in Deutschland, "Silent Sozial Corruption", thematisiert
seine Reflexion und Prüfung der aktuellen Situation der
Welt. Er spricht eindeutig und mutig über hochsensible Themen,
mit denen wir heute als gesamte Gesellschaft konfrontiert sind.
Lulaj möchte provozieren. Nicht nur die Autoritäten,
sondern uns alle. Denn in gewisser Weise sind wir alle schuldig.
Schuldig durch unsere passive und gleichgültige Art zu leben.
Wir spielen ohne es zu merken die Hauptrolle in dieser korrumpierten
Gesellschaft.
Die Katastrophen und Desaster des Kapitalismus und der diktatorischen
Fehlschläge des letzten Jahrhunderts werden uns durch Arbeiten
wie "Schizophrenic Nostalgia" und "Passion"
vorgeführt. In der Lightbox-Arbeit "Schizophrenic Nostalgia"
wird die Nostalgie durch Wiederholung und Verdopplung schizophren.
Der Stern als Symbol für den Sozialismus wird vom Künstler
als symmetrisch gespiegeltes Bild verdoppelt ein Verweis
auf die symmetrischen Symbole eines Psychiaters, der damit die
Schizophrenie seiner Patienten attestiert. Auch die front
and rear Projektion "Passion" reflektiert die Geschichte
des vergangenen Jahrhunderts: In einer Schlachterei sprechen
drei Männer über Kommunismus und westlichen Fortschritt.
Die Arbeit "Reflection on Black" handelt von der Wirtschafts-
und Machtlobby. Sie ist unter anderem ein Verweis auf den Roman
"Petrolio" von Pier Paulo Pasolini über die Zusammenhänge
von Staatsmacht und luxuriösem Politikerleben. Der erste
Teil der Arbeit spielt in Rom. Dort trägt der Künstler
ein mit Öl gefülltes Fass herum und spiegelt in der
Oberfläche des Öls die Altstadt von Rom und reflektiert
damit sowohl historische, als auch stark von Korruption geprägte
Orte. Im zweiten Teil platziert Lulaj ein leeres Ölfass
vor dem Sitz der UN in New York einer architektonischen
Struktur, die dazu dient globale Demokratie zu sichern. Dieses
Projekt spielt auf den Skandal um die "Oil for food Campaign"
in der UN zwischen 1996 und 2003 an, währenddessen hohe
Beamte millionenschwere private Geschäfte mit Ländern
wie Kuwait und Irak gemacht haben. Die UN soll weltweit Demokratie
und ihre Strukturen sicherstellen, ist aber selbst nur Spielball
der Mächtigen.
Für die Ausstellung hat Lulaj während der zwei Monate,
die er in der Villa Waldberta in München Stipendiat war,
zwei neue Arbeiten produzieren lassen. Der erste Teil der Arbeit
"WORK SETS YOU FREE" stellt eine site specific
Intervention dar, während derer fünf in Deutschland
lebende Migranten aus Palästina, Afghanistan, Iran und Kurdistan
gegen Bezahlung im Angesicht von zwei (ebenfalls bezahlten) Dobermännern
eine Stunde lang aushalten mussten. Die fotografische Dokumentation
dieser Aktion wird in der Ausstellung zusammen mit einem Neonschriftzug
mit dem spiegelverkehrten Wortlauf "arbeit macht frei"
ausgestellt. "WORK SETS YOU FREE" handelt von Flüchtlingen,
Migration, politischem Asyl, Rassismus, Bürokratie sowie
generell von Arbeitsmigranten in Europa. Die in Deutschland lebenden
Migranten sollten in dieser Aktion ihre eigene Lebensrealität
darstellen, auch wenn diese in den Kontext eines Kunstraumes
verschoben wurde. Lulaj erklärt dazu "die heutigen
Juden sind die Menschen aus Palästina, Afghanistan, Irak
und Kurdistan."
Die zweite für die Ausstellung in der Lothrigner13 produzierte
Arbeit, die als eine Art Orientierung für die ganze Ausstellung
dienen kann, ist der Neonschriftzug "WHEN YOU COME HERE
WHAT YOU SEE HERE WHAT YOU HEAR HERE WHEN YOU LEAVE HERE LEAVE
IT HERE". Diese Arbeit funktioniert als eine Art POLITICALMASTURBATION:
Wenn wir die Ausstellung ansehen, "sehen" wir sie nicht
nur an, sondern wir "kommen" auch in einem anderen
Kontext. Ursprünglich stammt diese Anweisung aus dem Kontext
der rassischen Segregation in den USA und verweist auf einige
Grundregeln, die dort zu befolgen waren. Beide Neonschriftzüge
wurden in Albanien produziert, von illegalen aus China stammenden
Arbeitern.
Der Künstler ist bekannt für das Auslösen von
provokativer Unruhe, welches ihm des Öfteren Ärger
mit dem Staat und anderen Autoritäten eingebracht hat. Gleichzeitig
sucht der Künstler aber auch genau das: Reaktionen und Feedback.
Indem er seine "künstlerische Freiheit" geschickt
ausnutzt, definiert Lulaj neue Grenzen und Standards er
sucht und kämpft für neue performative Räume.
Armando Lulaj's investigative und provokative Recherchen kulminieren
somit in einem Kunstwerk, welches nicht nur für die Kunstwelt
interessant ist. Die meisten seiner Projekte haben kein klares,
kein vordefiniertes Ende. Sie sind vielmehr Teil eines Entwicklungsprozesses,
der eng mit der jeweiligen Thematik verknüpft ist.
Ein gesonderter Ausstellungsraum in der Lothringer13 Städtische
Kunsthalle München wird von Armando Lulaj Münchener
Künstlern zur Präsentation ihrer eigenen Arbeiten angeboten.
Bewerber können den Künstler über die Webseite
der Lothringer13 persönlich kontaktieren, woraufhin er entscheidet,
ob er die Arbeiten der Künstler zeigen möchte oder
nicht.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit Beiträgen von
Pier Luigi Tazzi, Marco Scotini und Edi Muka.
Adela Demetja
Kuratorin der Ausstellung
Armando Lulaj und Adela Demetja sind Stipendiaten der Villa
Waldberta, der wir hiermit ausdrücklich für ihre Unterstützung
danken möchten.
r Karin Abt-Straubinger Stiftung unterstützt.
lothringer13/laden lädt ein
Unsere nächsten Performances im Rahmen von FLUXUS 3000:
HEUTE, Sa, 06. Februar 2010, 19 Uhr
Dorothea Seror: NON GRATA
Di, 09. Februar 2010, 19 Uhr
Philipp Gufler: Narzissus
Do, 11. Februar 2010, 19 Uhr
Tina Trümmer: Tina Trümmer und das
süße Leben
FLUXUS 3000
Zehn Versuchsanordnungen zur Zukunft der Performancekunst
4. 27. Februar 2010
Eine Veranstaltungsreihe von PROJEKT PERINEUM 2000 | Konzept:
Carmen Runge
Spektakel, Inszenierung, Infiltration des Alltags, Subversion,
Theater, Körperarbeit:
Was ist und was will zeitgenössische Performancekunst? Und
was macht sie zeitgenössisch?
Kann Performance authentisch sein? Oder ästhetisch? Oder
politisch relevant? Oder alles zugleich?
Kann man als Künstler den Zuschauer noch bewegen? Und was
kann man überhaupt bewegen?
Die Kunst? Die Gesellschaft?
Welche Tabus kann man noch brechen? Und wozu sollte man?
Und sind die Grenzen der Performance ausgereizt, wenn alle Tabus
gebrochen sind?
FLUXUS 3000 wird insgesamt zehn Performances Münchner
Künstler präsentieren, die Fragen wie diese aufwerfen
und künstlerisch verhandeln als Performances über Performance.
Der zum >black cube" umgestaltete Ausstellungsraum fungiert
als offener Inszenierungsrahmen und Depot für die Relikte
der einzelnen Veranstaltungen.
Zur Eröffnung (Intro) und zur Finissage (Outro) finden
Gesprächsrunden statt, die als gegenseitige Frage-Antwort-Situationen
zwischen je drei bis vier jungen Performern und etablierten Performancekünstlern
bzw. Theoretikern angelegt sind. Das Publikum ist eingeladen,
die Diskussionen durch eigene Beiträge mitzugestalten.
ALLE TERMINE | Beginn der Veranstaltungen jeweils 19 Uhr
Do, 04. Februar 2010
Intro (Eröffnungsgespräch)
Performance: Peter Bulla: Love Squad against performance about
performance
Sa, 06. Februar 2010
Dorothea Seror: NON GRATA
Di, 09. Februar 2010
Philipp Gufler: Narzissus
Do, 11. Februar 2010
Tina Trümmer: Tina Trümmer und das süße
Leben
Sa, 13. Februar 2010
Stefanie Trojan
Di, 16. Februar 2010
Heike Jobst & Angela Stiegler: Death Without Dying
Sa, 20. Februar 2010
Stephan Janitzky: postproblematisches vehalten / katastrophe
inhalt: puh a lectureperformance again
Di, 23. Februar 2010
Isabelle Pyttel: TRAN
Do, 25. Februar 2010
FUNDA: Die Fatiha
Sa, 27. Februar 2010
Outro (Bilanz)
Performance: Max Schmidtlein & Barbara Spiller: macht
kaputt, was ihr wollt und mögt
Im Projektfenster apollo13:
Peter Bulla: LOVE SQUAD
Liebe stets und wolle, dass diese Liebe allgemeingültig
wird.
5. 27. Februar 2010 | von außen jederzeit einsehbar
Eröffnung am Donnerstag, 4. Februar 2010, 19 Uhr
Love Squad kann verstanden werden als überparteiliches
politisches Bekenntnis, als aktionistisches Liebes-Terrorkommando,
als religiöse und spirituelle Konfession oder aber als Musikband
und Merchandising-Team ein Organismus, der seine Entfaltung auf
verschiedenste Art finden kann.
Frei nach dem Motto >If you are not against us, you are with
us" bietet Love Squad den passenden Mikro- und Makrokosmos
für jeden denkbaren Aktionismus.
Als ersten Schritt vom gedachten Regime hin zur gelebten Weltherrschaft
der Liebe ermöglicht es die Vereinigung Love Squad
ihren Anhängern, Sympathisanten und allen anderen Liebenden,
ihre Gesinnung und Gefühle physisch auszudrücken. >Wir
bringen Euch erstmal T-Shirts", sagt Love-Squad-
Gründer Peter Bulla: nämlich in Form einer exklusiven
Shirt-Kollektion in den angesagten Farben Neon-Blau, Neon-Pink
und Neon-Grün, die ab sofort in ausgewählten Boutiquen
der Metropolen Berlin, Wien und München erhältlich
ist. Und natürlich im lothringer13/laden.
http://love-squad.com
Newsletter
Katalogpräsentation
Heidi Sill
Ähnliche Wirkungen
18.03.2010
20.0022.00 Uhr
Einführung und Gespräch mit Michael Tacke und Dr.
Thomas Heyden
Die von Matthes & Seitz Berlin herausgegebene Publikation
Ähnliche Wirkungen" versammelt drei zentrale Werkgruppen
der in Berlin lebenden Künstlerin Heidi Sill. In den Textbeiträgen
von Gunter Reski, Ludwig Seyfarth und Marcus Steinweg beleuchten
die Autoren die Arbeit der Künstlerin in autonomen Textbeiträgen
aus ihrer jeweiligen Perspektive als Autor/Künstler, Kunstkritiker
und Philosoph.
Heidi Sill beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen
Physiognomie und Personalität. Dabei bildet sie in der Werkgruppe
der skins" die Silhouetten von Menschen ab und setzt sie
in einem zeichnerischen Prozess neu zusammen. Sie untersucht
einerseits den Begriff der Schönheit in unserer Gesellschaft
als körperliches Phänomen; andererseits richtet sich
ihr Interesse auf die Individualität, die sich in dieser
äußeren, zuweilen fast genormten Kontur sichtbar erhält.
Die Reduktion der Vielfalt physiognomischer Eigenheiten reduziert
die Menschen durchaus nicht zum unterschiedlosen entindividualisierten
Objekt. Heidi Sill leitet vielmehr wie in den physiognomischen
Studien des 19. Jahrhunderts aus dem Einzelphänomen Spuren
des Allgemeinen ab. Dabei verdichtet sich die Summe der Einzelmerkmale
zu einer Typologie der Standards und Abweichungen. Die Zeichnung
bildet ab was sein könnte, wenn man statt des fotografischen
Details die Vielgestalt der Wirklichkeit hinter den äußeren
Oberflächen erfassen könnte.
In dem Werkkomplex der cuts" und models" beschäftigt
sich die Künstlerin mit einem vergleichbarem Problem. In
den Collagen, werden durch Schnitte und Überlagerungen die
normativen Prinzipien von Schönheit" untersucht. Hinter
der glamourösen Oberfläche lauert quasi als natürliches
dahinter ein möglicher Abgrund aus Verletzbarkeit und Zerstörung.
Die Lust des Betrachters an der Oberfläche ist immer auch
ein Spiel mit einem möglichen oder unmöglichen
Dahinter. Mit dem Skalpell als Werkzeug der Collage seziert
Heidi Sill die glänzenden und retuschierten Bilder auf ein
mögliches Verborgenes hin, und offenbart dabei wie sich
der flüchtige und affizierende Glamour plötzlich in
das Gegenteil verkehren kann.
Diese Befragung der Oberfläche verkehrt sich bei den
models" gleichfalls in ihr Gegenteil: statt die Oberfläche
zu durchdringen, transparent zu machen und sie zu überlagern,
wird auf die Gesichter eine zusätzliche Schicht aufgetragen.
Diesmal nicht als Schnitt auf der Suche nach einem möglichen
Dahinter, sondern als Faktur, welche die Makellosigkeit der inszenierten
Gesichter unterminiert, sie möglicherweise aus ihrer Konformität
befreit und zu verletzbaren Individuen macht.
Die Publikation umfasst 120 Seiten mit 64 Abbildungen und
wurde mit freundlicher Unterstützung der Erwin und Gisela
von Steiner Stiftung München und der Stiftung Künstlerdorf
Schöppingen realisiert.
Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin
ISBN 978-3-88221-637-0 Öffnungszeiten DiSo, 14.0020.00
Uhr, Eintritt
|