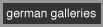german galleries / index cities / index galleries / index artists / index Cottbus
Brandenburgische Kunstsammlungen Cottbus
seit 2009: Dieselkraftwerk
Cottbus
über die Brandenburgischen
Kunstsammlungen
aktuelle Ausstellung / current exhibition
vorausgegangene Ausstellung
/ previous exhibition
Pfingsten - 31.5. und 1.6. 1998: 10 - 18 Uhr
10.5. - 5.7. 1998
Junge Kunst
Saar Ferngas Förderpreis 1998
Preisträger
Nun bereits zum vierten Male präsentieren sich in Cottbus die Preisträger des seit 1986 alle zwei Jahre ausgeschriebenen Kunstpreises. In jeweils erweiterter Werkauswahl - im Unterschied zur diesmaligen Ausstellung im Saarland Museum Saarbrücken, wo alle 38 Künstler der Wettbewerbsendrunde beteiligt sind - wird den vier preisgekrönten Künstlern die Möglichkeit gegeben, ihren Schaffensansatz stärker zu verdeutlichen. Wenn sich ein Charakteristikum für die diesjährige Ausstellung herausschälen ließe, so vielleicht jenes, vom Bild, von der Bildhaftigkeit ausgehend konzeptionell deren Grenzen und weiterführenden Möglichkeiten zu erforschen. Das geschieht einerseits streng, andererseits spielerisch, wobei Positionen der Malerei ebenso vertreten sind, wie auch die der Fotografie, Objektkunst und Installation. Der Hauptpreisträger ist der Hamburger Matthias Fickinger, ein Künstler, der mit den unterschiedlichsten Medien arbeitet. Seine "Installation ohne Titel" (1996/97) unternimmt einen gewitzten Eingriff in gewohnte Bahnen: Ansichtskarten aus aller Welt, die er von Freunden übersandt bekam, werden ausschnitthaft in Malereien auf Dachlatten ühersetzt. Zu diesen an der Wand installierten Teilen gesellt sich ein handelsüblicher Postkartenständer, nun mit Karten bestückt, die die Details der Malerei und die auf den Karten anzutreffenden Grußbotschaften auf neue Weise vereinen. Ein gelungener Kunstkommentar, der aus dem Klischee ausbrechend symbolhaft eigene Kulturkreisläufe erzeugt. Andrea Hold-Ferneck aus Wuppertal erhielt in diesem Jahr den 2. Preis. Sie operiert mit dem Begriff "Ensemble". Wir sind etwa an die Musik erinnert, wo das Zusammenwirken verschiedenster Instrumente in einer Gruppe gemeint ist (im Französischen: zusammen, miteinander, zugleich, insgesamt). Diese Werkbezeichnung für die Installationen der Künstlerin eröffnet neue Denkansätze, denn unterschiedlichste Zeichen- und Realitätsebenen begegnen sich hier. Realobjekte, neben Fotografien von Gegenständen und abstrakte, teils wieder bildkörperhaft werdende Fotogramme sind zu Konstellationen verbunden. Ein vielleicht zunächst fremd anmutendes Ganzes, das - auf den vorhandenen Raum reagierend - Fragen nach unserer Wahrnehmung in der fliegenden Wechselbeziehung der Dinge stellt. Der in Berlin lebenden Koreanerin Jinran Kim wurde der 3. Preis zuerkannt. Eines ihrer eigenwilligsten Werke ist das "Soapproject" (Seifenprojekt) aus dem Vorjahr. Wie in einem Schrein werden die fünf benutzten Seifenstücke aufbewahrt. Die Künstlerin hatte diese für einen bestimmten Zeitraum Freunden überlassen und sie gebeten, darüber persönliche Aufzeichnungen zu führen. Letztere sind in Buchform in Fächern untergebracht und erlauben dem Leser Einblicke in die Lebensabläufe der Seifenbenutzer. Was sich zunächst als Geheimnis zeigt, offenbart etwas ganz Gewöhnliches. Auch in diesem Jahr wurde wieder ein Sonderpreis vergeben, den die Malerin Antje Smollich aus Springe (bei Hannover) entgegennehmen konnte. Ihre Tafelbilder erfahren schwebende Erweiterung üher das Bildgeviert in den Umraum. Dies gewinnt die Kiinstlerin durch die Verwendung von Acrylglasplatten, die mittels Verschiebung über die Grundform hinausragen und zwischen denen Farbschichten ihr Eigenleben entfalten. In weiteren Stationen wird diese Ausstellung im Kunstverein Ludwigshafen und im Bad Kreuznacher Schloßparkmuseum zu sehen sein. Es erscheinen Katalog und Plakat.
Jörg Sperling
Öffentliche Führungen: 16.6., 23.6., jeweils 19.30
Uhr und 24.5., 16 Uhr, Jörg Sperling
20.5. - 5.7. 1998
Lex Drewinski
Message
Polnische Plakatkunst
Das polnische Plakat, das wie die Schweiz und Frankreich wegen
seiner Tradition weltweit große Anerkennung genießt,
hat Eigenarten, durch die es sich von denen anderer Länder
unterscheidet. Diese Andersartigkeit erklärt sich unter
anderem aus der wechselvollen Geschichte Polens die immer wieder
das Bekenntnis zur eigenen Identität herausforderte. Das
Plakat war das Medium, was Zeichen setzte und auch die Rolle
einer Straßengalerie übernahm. Die polnische Plakatkunst
löste sich bereits Ende der fünfziger Jahre weitaus
früher als in anderen früheren Ländern des Ostblocks
- von den propagandistischen Leitlinien in der Kommunikation
der Kunst und konnte auch durch das Fehlen kommerzieller Triebkräfte,
die auf andere Weise ebenso einengend wirken können wie
die ideologischen, ein großes Experimentierfeld entstehen
lassen. Das Plakat wurde mit künstlerischem Anspruch und
demokratischem Selbstverständnis zum Kunstwerk des "Mannes
auf der Straße". Trotz einer enormen Vielfalt von
Stilrichtungen und unterschiedlichen formalen und inhaltlichen
Erkundungen haben die polnischen Plakatkünstler eine gemeinsame
Sprache. Es ist oftmals eine surrealistische Betrachtungsweise,
der intelligente Witz und nicht selten ein Zug von schwarzem
Humor anzutreffen. Genau in dieser Tradition stehen auch die
Plakate von Lex Drewinski, dennoch weichen sie in ihrer formalen
Beschaffenheit von den Arbeiten vieler anderer polnischer Grafiker
ab die dem Oppulent-Malerischen zuneigen. Die Plakate von Drewinski
sind klar, knapp, direkt, geradezu spartanisch in der Form- und
Farbgebung. Trotzdem erschließen sich die Bildinhalte mitunter
nicht sofort. Der Künstler arbeitet mit der Symbolkraft
von Zeichen aus der alltäglichen Bildwelt. Er fügt
zusammen, was gewöhnlich nicht zusammen gehört und
verblüfft den Betrachter durch geringfügige Veränderungen
gewohnter Bilder. Auf sehr sensible Weise rückt er damit
brisante politisch-soziale Themen ins Bewußtsein. Als Beispiel
sei das Plakat "Kein schöner Land ...?!" erwähnt.
In Form eines Schattenspiels sind zwei Hände zu sehen, die
im Begriff sind, sich zum Gruß zu vereinigen. Sie symbolisieren
das Aufeinanderzugehen. Während sich die eine Hand bereitwillig
öffnet, verformt sich die andere zu einem Wolfskopf.
Die klare und großzügige Gestaltung seiner Plakate,
mit denen sich die Blätter aus der Bilderflut öffentlicher
Anschläge abheben, zeugt von seinem Feingespür für
die Form. Hinter den sehr sachlich wirkenden Linien, Flächen,
Farbfeldern verbirgt sich eine kraftvolle Emotionalität.
Dabei steigert der häufig verwendete Schwarz-Weiß-Kontrast
die Aussagekraft seiner Bilder und vermittelt zugleich ein starkes
Raumgefühl. Drewinski nutzt das Plakat, um "an mehreren
Plätzen in der Welt gleichzeitig aktiv Meinungen zu formulieren
und Haltungen zu manifestieren" Dabei ist er bemüht,
die Plakate als "Fenster zur Welt nicht unnötig zu
dekorieren, ...um klare Einsichten und Aussichten nicht zu verbauen"
(Aus: "Lex Drewinski - Posters", 1995). Weiter schreibt
er darin: "Ich hatte das Glück, in einem Land geboren
zu sein und dort studieren zu dürfen, wo das Plakat zur
Kunst zählte. Und die Professoren, die diese Kunst lehrten
waren gleichzeitig Vorläufer und Schöpfer der polnischen
Schule des Plakats, deren guter Ruf weit über die Grenzen
Polens hinwegreicht." Heute gibt er, ebenfalls zum Professor
berufen, sein Wissen an die Studenten der Fachhochschule Potsdam
weiter.
Barbara Bärmich
Öffentliche Führungen: 30.6., 19.30 Uhr, Barbara Bärmich
Vortrag: Di, 9.6., 19.30 Uhr: Das Plakat - Konzeption und
Entwurf
Prof. Lex Drewinski, Fachhochschule Potsdam