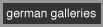german galleries / index
cities / index galleries
/ index artists / index
Munich
Pinakothek der ModerneBarerstrasse 40
30.05 - 16.08.2009 Tom Burr - Monica Bonvicini
In Zusammenarbeit mit der Städtischen Galerie im Lenbachhaus
und dem
Juni - September 2009 Mini - 50 Jahre ZukunftDer MINI ist das einzige Produkt, mit dem man sich anzieht. GRAPHIK
Herman ObristSkulptur | Raum | Abstraktion um 1900
Der Bekanntheitsgrad der Werke von Hermann Obrist (18621927) steht in keinem Verhältnis zur ihrer kunsthistorischen Bedeutung. In München begründete der gebürtige Schweizer in den 1890er Jahren die deutsche Variante der Jugendstilbewegung, die anspruchsvolles Handwerk der angewandten mit den ästhetischen Ansprüchen der freien, bildenden Kunst verschmolz.
Darüber hinaus aber schuf Obrist mit seinen Brunnen und Grabmälern die ersten abstrakten Skulpturen, die in der Verbindung von organischen und anorganischen Strukturen eine ganz eigene Sprache entwickeln, die nicht mit dem Schlagwort Jugendstil erklärt werden kann. Neben der Rekonstruktion dieses heute weitgehend unbekannten Werks zeigt die Ausstellung zudem, dass Obrists Idee, Bild und zeitgenössische Wissenschaft zu verknüpfen, große Aktualität für Kunst und Wissenschaft unserer Tage hat. Auch in der zeitgenössischen Kunst wird heute dieser Brückenschlag zur Wissenschaft gesucht. In seiner Auseinandersetzung mit der Fotographie ging Obrist zudem über den traditionellen Begriff des Bildhauers hinaus und erschloss paradigmatisch neue Wege für die Kunst des 20. Jahrhunderts. In dieser Ausstellung werden erstmals die Nachlassteile aus der Staatlichen Graphischen Sammlung München und der Kunstgewerbesammlung des Museums für Gestaltung Zürich im Museum Bellerive zusammengeführt und damit das Gesamtwerk des Zeichners, Bildhauers und Theoretikers greifbar. Darüber hinaus führen wichtige Zeitgenossen und Freunde wie August Endell, Henry van de Velde und Rudolf Steiner das Umfeld von Obrists Kunst vor Augen.
Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte Obrist bei der »Ausstellung für unbekannte Architekten« des »Arbeitsrats für Kunst« in Berlin 1919. Obrist wurde hier als Vaterfigur einer jüngeren Generation von expressionistischen Architekten und Bildhauern aufgenommen. Ein Ausblick auf Werke von Rudolf Belling, Hermann Finsterlin, Wenzel Hablik, Hermann Poelzig und Buno Taut schließt daher gemeinsam mit den abstrakten Skulpturen Obrists die Ausstellung ab. Die biomorphen Strukturen von Hermann Obrists kaum bekanntem bildhauerischem Werk werden in der Pinakothek der Moderne ihre Aktualität für die zeitgenössische Skulptur und Architektur beweisen können.
Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Museum Bellerive, ein Haus des Museums für Gestaltung Zürich, organisiert und zuvor dort gezeigt. Ein begleitendes Buch (deutsch-englisch, 248 Seiten, 180 Abbildungen, Verlag Scheidegger & Spiess, Zürich, 40 Euro in der Ausstellung, 49 Euro im Buchhandel) veröffentlicht erstmals die Nachlassteile in Zürich und München.
Kuratorium: Eva Afuhs, Zürich | Andreas Strobl, München | Viola Weigel (Konzept), Zürich/Wilhelmshaven
Ein öffentliches Symposium in der Pinakothek der Moderne am 18.09. und 19.09. stellt die Facetten des Werks vor und bietet die Möglichkeit, Obrists Position in der Geschichte der abstrakten Skulptur zu diskutieren. Vortragende: Hubertus Adam (Zürich), Bernd Apke (Gütersloh), Erich Franz (Münster), Christa Lichtenstern (Berlin), Forschungsprojekt »Hermann Obrist im Netzwerk der Künste und Medien um 1900« (Zürich).
ARCHITEKTUR September - Dezember 2009 Chinesische Architekturmodelle aus dem Nationalmuseum in Peking
Buddhistische Tempel, antike Palastanlagen und regionaltypische
September Dezember 2009 Thomas StefflIn den Skulpturen und Filmen des in München lebenden
Künstlers Kurator: Bernhart Schwenk
DESIGN 03.04. - 12.07. 2009 Ikea - Democratic Design
»Die schöne Form ist für alle da. Und nicht nur fürs Museum!«
Diese Äußerung eines IKEA-Chefdesigners von 1979 steht programmatisch für die Designpolitik jenes Unternehmens aus Südschweden, das seit 1948 durch seinen Gründer Ingvar Kamprad vom Einmannbetrieb zum größten Einrichtungskonzern der Welt ausgebaut wurde.
Die Neue Sammlung The International Design Museum Munich widmet dem Thema Democratic Design am Beispiel IKEA die erste große Museumsausstellung. Im Wechselspiel mit der permanenten Ausstellung des Museums erhalten die ausgewählten Objekte aus sechs Jahrzehnten ihren designhistorischen Kontext.
Aufgezeigt werden Aspekte wie System Billy, Do-it-Yourself, Design Process, Inspirationen, Kinder-Welt, Material Change und Nachhaltigkeit, die Wurzeln im Schwedischen, aber auch in der klassischen Skandinavischen Moderne von Aalto bis zu dänischen Einflüssen der 50er und frühen 60er Jahre. Die Exponate stammen aus der permanent collection der Neuen Sammlung, ergänzt um Leihgaben aus dem IKEA Museum, Älmhult, und um private Leihgaben von IKEA-Mitarbeitern.
Zur Vernissage um 19 Uhr sind Sie herzlich willkommen.
Eine Ausstellung der Neuen Sammlung The International Design Museum Munich in Kooperation mit IKEA.
Pressevorbesichtigung: 02.04.2009, 11.00 mit dem IKEA Chefdesigner Lars Dafnäs Eröffnung: 02.04.2009, 19.00
Jabornegg & PálffyBAUEN IM BESTAND Die Wiener Architekten Christian Jabornegg und András
Pálffy
Das Phänomen Bata. Der Funktionalismus is Zlin 1910 1960
Daniel Hopfer(1470 - 1536) Der Augsburger Radierer und Holzschneider Daniel Hopfer d.
Ä. gilt als
ARCHITEKTUR Dezember 2009 - Mai 2010 Wendepunkt im Bauen. Industrialisierung und Systembau
Pierre Mendell (1929 2008)
Pierre Mendell einer der führenden Graphikdesigner der Welt ist am 19.12.2008 im Alter von 79 Jahren in München verstorben. Fast 30 Jahre lang prägte er das Visuelle Erscheinungsbild der Neuen Sammlung The International Design Museum Munich. Für eine Veranstaltung dieses Museums im Februar 2009 entwarf Pierre Mendell vor wenigen Tagen sein jüngstes Plakat.
Mehr als 40 Jahre akzentuierten die Plakate von Pierre Mendell auf Litfasssäulen und Anschlagflächen in markanter Weise das Stadtbild Münchens; seit 1980 waren dies vor allem die Ausstellungsplakate für Die Neue Sammlung, von 1993 an kamen die Plakate der Bayerischen Staatsoper dazu. »Es ist die geistige Haltung, die gutes Graphic Design auszeichnet: stringent, in der Form reduziert, stets kraftvoll, nie etwas vortäuschend. So entwickelte Pierre Mendell eine Handschrift von höchster Eigenständigkeit, die flexibel auf die jeweiligen Aufgabenstellungen eingeht und dadurch den Themen in hohem Maße gerecht wird. Daher sind die Plakate von Pierre Mendell so einfach und überzeugend und über den Tag hinaus von Bestand.« (Florian Hufnagl, Die Neue Sammlung The International Design Museum Munich)
Das mit zahlreichen internationalen Auszeichnungen gewürdigte Oeuvre des Graphikdesigners Pierre Mendell (geb. 1929 in Essen) besaß gleichsam als Brennpunkte zwei international agierende Kulturinstitutionen: Die Neue Sammlung, für die er von 1980 bis 2003 Jahr für Jahr sowohl Plakate als auch das gesamte Visuelle Erscheinungsbild gestaltet hat, und die Bayerische Staatsoper, für die er 1993-2006 in vergleichbar umfassender Weise tätig war. Die Zusammenarbeit zwischen der Neuen Sammlung und Pierre Mendell wurde auch zum Auslöser einer ungewöhnlichen Plakatserie für die Museen in München ein einzigartiges Projekt, das neben den Staatlichen auch die Städtischen Museen und das Deutsche Museum umfasst. Im Jahr 2003 wurde die Serie der Öffentlichkeit vorgestellt:
Geburtsstunde des neuen Kunstareals Mehr als 60 Experten entwickeln heute und morgen auf der Konferenz "Kunstareal München" die Grundlagen für eine neue kulturelle Mitte in München
München, 17. April 2009 Das Ziel ist ambitioniert, aber nicht unerreichbar: Die Münchner Museumslandschaft soll in den nächsten zwei Jahrzehnten ein neues Gesicht bekommen. Heute und morgen diskutieren nationale und internationale Museumsexperten, Architekten und Stadtplaner, wie es aussehen soll. Auf der Konferenz "Kunstareal München" entwickeln sie konkrete Perspektiven für die Pinakotheken, das Kunstareal und dessen städtebauliche Einbindung.
Museen prägen das Gesicht einer Stadt und wirken weit über ihre eigentliche Funktion hinaus. Obwohl München zahlreiche Museen von Weltrang hat und die Aktivität im Kunstareal hoch ist, wirkt das Gebiet rund um die drei Pinakotheken und den Königsplatz bis heute unstrukturiert und unvollendet. Daher hat die Stiftung Pinakothek der Moderne im vergangenen Sommer zunächst die öffentliche Diskussion um die Weiterentwicklung des Kunstareals angeregt.
Nun findet auf Initiative der Stiftung im Amerika Haus und in der Pinakothek der Moderne die internationale Konferenz "Kunstareal München" statt. Unter fachlicher Leitung von Prof. Sophie Wolfrum, Inhaberin des Lehrstuhls für Städtebau und Regionalplanung der Technischen Universität München, werden heute und morgen über 100 Fachleute in München die inhaltlichen Grundlagen für einen Masterplanwettbewerb erarbeiten. Den Veranstaltern ist es gelungen, international bekannte Museumsexperten, Architekten und Stadtplaner mit Repräsentanten aller beteiligten Institutionen und Gremien an einen Tisch zu bringen.
"Mit unserer Konferenz haben wir die Plattform für einen inhaltlich getriebenen Diskurs geschaffen. Von der Zusammensetzung der Teilnehmer erwarten wir ein Ergebnis, das den aktuellen Stand der Museumsgestaltung weltweit widerspiegelt, gleichzeitig aber die spezifischen Bedürfnisse und Potenziale hier in München im Blickfeld hat", sagt Dr. Markus Michalke, Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Pinakothek der Moderne. "Besonders freuen wir uns auch darüber, dass Staatsminister Dr. Heubisch als Vertreter der Staatsregierung und Stadtbaurätin Dr. Elisabeth Merk für die Stadt München aktiv an der Diskussion teilnehmen werden", betont Dr. Michalke. Auf Grundlage aller gewonnenen Ergebnisse solle dann in einem Masterplanwettbewerb eine konkrete gestalterische Lösung gesucht werden, erklärt der Stiftungsratsvorsitzende weiter.
Der erste Tag der Konferenz ist dem Blick von außen auf das Kunstareal gewidmet. Internationale Museumsexperten und Architekten arbeiten in einer Vortragsreihe die Schlüsselelemente vergleichbarer Projekte heraus. Es sprechen: Moderation: Im moderierten Tischgespräch am morgigen Samstag diskutieren mehr als 50 Experten verschiedenster Fachrichtungen mit politischen Entscheidungsträgern und den im Kunstareal arbeitenden Sammlungsleitern über konkrete Zukunftskonzepte für das Kunstareal München. Gesucht werden Lösungsansätze auf die Frage, wie vorhandene Raumprobleme im Einklang mit den neuesten Museumskonzepten gelöst und mit welchen architektonischen und städtebaulichen Mitteln die öffentliche Wahrnehmung der Häuser als Museen von Weltrang sicher gestellt werden können. Eine entscheidende Rolle wird aber auch die Diskussion darüber einnehmen, wie die Institutionen im Kunstareal miteinander architektonisch und funktional vernetzt und in ihre nächste Umgebung eingebettet werden können. Die Stiftung Pinakothek der Moderne wird die Ergebnisse der Konferenz "Kunstareal München" der Öffentlichkeit in einer Dokumentation zugänglich machen.
Über die Stiftung Pinakothek der Moderne Die 1994 gegründete Stiftung Pinakothek der Moderne ist aus dem Bewusstsein heraus entstanden, dass bürgerschaftliches Engagement notwendig ist, um unserer Gesellschaft entscheidende Impulse für ihre Weiterentwicklung zu geben. Mit Spenden in Höhe von rund 26 Millionen DM ermöglichte sie den Bau der Pinakothek der Moderne. Heute unterstützt die Stiftung, die über den Einsatz ihrer Mittel selbst bestimmen kann, die Sammlungen der Pinakothek der Moderne bei ihrer Arbeit und bei der Umsetzung ihrer Projekte.
Pressemitteilung Forschungsprojekt Die staatlichen und städtischen Museen in München starten zum 1. Juni 2009 ein von der Arbeitsstelle für Provenienzrecherche/-forschung in Berlin bundesweit erstmalig gefördertes Kooperationsprojekt mit dem Thema: Das Schicksal jüdischer Kunstsammler und Händler in München 1933-1945. Das Projekt wird bearbeitet von Dr. Vanessa-Maria Voigt, Autorin des Buches über die Sammlung Sprengel von 1934 bis 1945, zuletzt für die Stadt Hannover tätig, und Horst Kessler M.A., bekannt als Autor über Karl Haberstock und Provenienzforscher für die Kunstsammlungen und Museen der Stadt Augsburg. Die Projektleitung liegt bei Dr. Andrea Bambi, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Dr. Irene Netta, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Bernhard Purin, Direktor des Jüdischen Museums. Das Forschungsprojekt ist für voraussichtlich drei Jahre angelegt.
Im Winter 1938/39 beschlagnahmte die Geheime Staatspolizei München im Rahmen der so genannten »Judenaktion« Kunstwerke aus jüdischem Privatbesitz. Diese wurden zunächst im Bayerischen Nationalmuseum und im Münchner Stadtmuseum deponiert, dann an die Pinakotheken, die Graphische Sammlung, das Nationalmuseum, das Münchner Stadtmuseum und die Städtische Galerie verteilt. Die jeweiligen Direktoren schätzten den Wert der Kunstwerke, die erfolgten Zahlungen standen jedoch den Eigentümern nicht mehr zur Verfügung, da die NS-Gesetze ihnen keinerlei freie Verfügung über ihr Vermögen mehr erlaubten. Nach Kriegsende fand man die Kunstwerke zusammen mit denen der bayerischen Museen in den Bergungsorten auf. Von dort wurden sie von den Alliierten an die Central Collecting Points in München und Wiesbaden verteilt und so weit möglich an die rechtmäßigen Eigentümer bzw. deren Rechtsnachfolger restituiert.
Auf Basis der im Münchner Stadtmuseum 2007 aufgefundenen Beschlagnahmungslisten von 1938/39 und der im so genannten ALIU Report (Art Looting Investigation Unit, Final Report, Washington 1. Mai 1946) erfassten Namen von Kunstsammlern und Händlern jüdischer Herkunft soll dieses Kapitel jüdischen Lebens in München erschlossen werden. Ziel des Forschungsprojekts sind Kurzbiografien der bislang circa 70 Sammler und 30 Händler, die Identifizierung ihres Kunstbesitzes sowie die Beschreibungen der Kunsthandlungen. Historisch bedingt hatte die Mehrzahl der Münchner Kunsthändler seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen jüdischen Familienhintergrund. Bekanntere Namen sind die von Otto Bernheimer, Heinrich Thannhauser und Fritz und Hugo Helbing. Die Kunsthandlung der letzteren wurde »arisiert« und weitergeführt. Heinrich Thannhauser verstarb 1934, sein Sohn musste das nationalsozialistische Deutschland verlassen und emigrierte 1939 von Paris aus in die USA, wo er sich in New York eine neue Existenz aufbaute. Sehr ausführliche Forschungen wiederum existieren beispielsweise zu den Sammlungen von Alfred Pringsheim und Siegfried Lämmle. Wer aber waren Siegfried und Johanna Adler, Julius Davidsohn und Margarethe Katzenstein, um nur einige der 70 Namen zu nennen, deren Sammlungen im Dezember 1938 beschlagnahmt wurden? Und woher stammten die präzisen Informationen, mit denen die Sammlungen aufgespürt werden konnten? Diesen Fragen stellt sich das Projekt und wird so auch die Sammlungsgeschichte der beteiligten Häuser und deren Erwerbungspolitik erhellen.
Beteiligte Museen sind die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, das Jüdische Museum München, die Städtische Galerie im Lenbachhaus, das Münchner Stadtmuseum, das Museum Villa Stuck, das Bayerische Nationalmuseum und die Staatliche Graphische Sammlung.
DIE SAMMLUNG DES ARCHITEKTURMUSEUMS DER TU MÜNCHEN WIRD DIGITALISIERT Der enorme Archivbestand des Architekturmuseums mit Dokumenten aus dem 16. Jahrhundert bis heute ist das historische »Gedächtnis« der Fakultät für Architektur und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Architektur. Kontinuierlich wachsen die Bestände durch die Übernahme von Nachlässen bedeutender Architekten weiter an. Heute umfasst das größte Spezial- und Forschungsarchiv für Architektur in Deutschland ca. 500.000 Zeichnungen und Pläne von annähernd 700 Architekten, über 100.000 Originalphotographien sowie eine Vielzahl an Modellen und Archivalien. Die Spannweite an Arbeiten namhafter Architekten reicht von Balthasar Neumann bis Le Corbusier und von Leo Klenze bis Peter Zumthor. Das Architekturmuseum und die Universitätsbibliothek der TUM starten, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), ab Juni 2009 die Digitalisierung der Plansammlung des Archivs. Das DFG-Projekt trägt dazu bei, die wertvollsten Planbestände des Architekturmuseums zu sichern, ihre Verwaltung zu erleichtern und durch eine hochauflösende Digitalisierung, Erschließung und Online-Präsentation für Forschung, Lehre und Öffentlichkeit optimal zugänglich zu machen. Während der zweijährigen Projektlaufzeit werden die erstellten Digitalisate kontinuierlich in die Datenbank eingebunden. Eine Auflistung des Inventars ist ab sofort unter http://www.architekturmuseum.de abrufbar.
|
||
| germangalleries.com - index München | ||